Nennen wir die Dinge beim Namen: Der größte Feind von persönlichen Höchstleistungen ist der eigene Kopf. Egal ob auf der Bühne oder in einer Sportarena – zumeist gibt es einen Leistungsabfall gegenüber dem Übezimmer oder dem Trainingsraum. Warum ist das so? Und wie lassen sich Angst und Stress durch Genuss ersetzen?
Google dürfte es (negativ) aufgefallen sein, den Lesern, die den Weg zu diesem Artikel gefunden haben, wohl eher nicht: Bis zu diesem Satz kommt nirgendwo das Wort ‚Trompete‘ vor. Das hat einen einfachen Grund: Was wir gemeinhin als Lampenfieber bezeichnen, ist natürlich kein Phänomen, dass sich auf Trompeter oder Musiker beschränkt, sondern bei allen Menschen auftreten kann, die eine besondere Leistung erbringen müssen. Zu wissen, zu einem bestimmten Zeitpunkt stark ge- oder gar überfordert zu werden, setzt einen bereits im Vorfeld unter Druck.

Lampenfieber oder Auftrittsangst kann ein Sportler genauso haben wie ein Prüfling in der Schule oder ein Dissertant vor einem Promotionsausschuss, ein stotternder König, der eine Rede halten muss, genauso wie ein Abteilungsleiter, dem eine Präsentation vor der Geschäftsführung bevorsteht, ein Schauspieler, eine Opernsängerin oder eben auch ein Trompeter. Lampenfieber ist die Angst vor dem eigenen Versagen. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Angst die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Versagen tatsächlich eintritt, und somit quasi berechtigt ist. Das klingt nach self-fulfilling prophecy und am Ende nach Teufelskreis. Keine Panik! Unausweichlich sind solche Zustände keineswegs.
Von trockenen Lippen bis zum feuchten Arsch: Angst kennt viele Gesichter
Ein trockener Mund und trockene Lippen, Verdauungsbeschwerden zwischen flauem Magen und Flitzekacke, feuchte Hände, zittrige Arme und so weiter und so fort. All das sind körperliche Symptome, die uns nicht nur signalisieren „Eigentlich wollen wir nur weg aus dieser brenzligen Situation“, nein, sie behindern die Leistungsfähigkeit zusätzlich massiv. Üblicherweise bekommen gerade Trompeter einen trockenen Mund und Pianisten schweißnasse Hände – also genau das, was sie eben überhaupt nicht brauchen können. Das kann so weit gehen, dass man als Musiker wirklich für eine gewisse Zeit spielbehindert bis spielunfähig ist. Der eigene Apparat aus Körper und Geist zieht hier die Notbremse vor Überforderung. Und genau hier muss man ansetzen: Ein Auftritt sollte einen fordern dürfen, jedoch nicht überfordern. Diese simple Erkenntnis deckt sich auch mit Thomas Ganschs Aussage: „Nervös war ich nur, wenn ich entweder schlecht vorbereitet oder am Vortag saufen war.“ Wer weiß, dass er etwas sicher kann, wird in der Regel nur wenig mit Nervosität zu kämpfen haben, wenn er die gewohnte Leistung abzurufen hat.
Gründe für Lampenfieber
Grundsätzlich herrscht also eine negative Reziprozität zwischen Auftrittsangst und Vorbereitung. Je besser man vorbereitet ist, desto geringer fällt die Angst aus und umgekehrt. Natürlich spielt der Faktor Individuum auch eine erhebliche Rolle. Es gibt Menschen, die mit Stress viel besser umgehen können als andere: Manche rufen selbst (oder gerade!) unter Druck 100 % ihres Potentials ab, andere wiederum verlieren 80 %, wenn es zur Sache geht. Auf eine solche Hypernervosität, die von einer grundsätzlich schwierigen psychischen Konstitution (oft verursacht durch Traumata, Familiengeschichte oder Ähnlichem) herrührt, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Hier muss unbedingt ein Spezialist helfen, durch dessen gründliche Arbeit sich wahrscheinlich dann nicht nur das Trompetenspiel, sondern die gesamte Lebenssituation verbessern wird. Und die sogenannten „Rampensäue“, die erst unter Druck zu Höchstform auflaufen, haben sowieso Probleme nur im Proberaum mit ihren Musikerkollegen…
Schlechte Vorbereitung alleine macht nun noch kein Bauchweh – sie muss gepaart sein mit Ambition. Jeder Musiker ist in seinem Leben ganz sicher Leuten begegnet, denen es egal ist, dass sie einen Auftritt zu bewältigen haben und dem eigentlich nicht gewachsen sind. Das sind die Unberührbaren. Der Adrenalinspiegel bzw. der Angstpegel steigt erst dann, wenn man etwas gut machen will, das aber nicht (zu 100 %) kann. Lampenfieber kommt also am ehesten und ganz nachvollziehbar dort auf, wo es eine negative Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Potenz gibt oder anders ausgedrückt: Wollen bzw. Sollen größer sind als das Können.
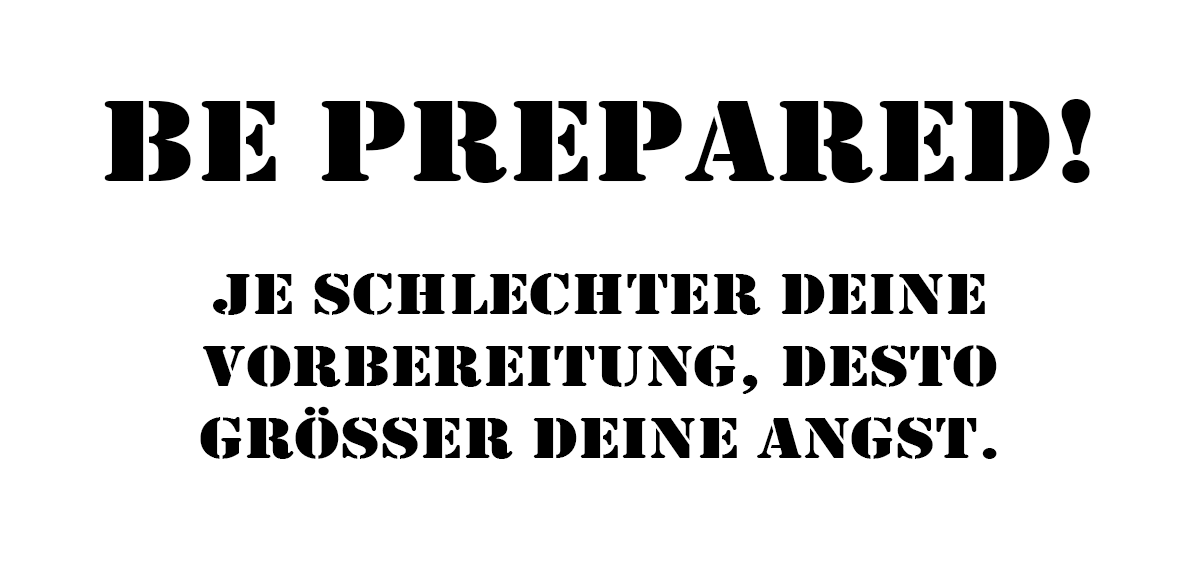
Der TrumpetScout kennt das ganz gut aus der eigenen Erfahrung. Die Größe des Publikums spielt dabei tatsächlich keine so große Rolle, die Furcht vor der Blamage multipliziert sich nicht mit der Zahl der Zuhörer. Sein stärkster Kritiker ist man als ambitionierter Spieler immer selbst und dann möchte man sich als nächstes vor den Kollegen gut präsentieren. Bauchweh und Rastlosigkeit kommt beim Autor dieser Artikels also bis heute nur dann, wenn die Literatur zu schwer ist oder im Ensemble zu wenig geprobt wurde und die Chancen auf Erfolg dadurch schlecht stehen.
Jedes Solo ein Trauerspiel?
Spielt es für die Nervosität eine Rolle, ob man im Satz bläst oder alleine? Die meisten werden nun innerlich ausrufen: „Natürlich!“ Klar, wer exponiert spielt, wird einfach am besten wahrgenommen, ergo werden auch Fehler besser bemerkt. Das erhöht wieder die Erwartungshaltung und befeuert somit das Lampenfieber. Dennoch sieht der TrumpetScout die Einhaltung der ersten Regel im Kampf gegen Angst auch hier als bestes Beruhigungsmittel: Beherrsche, was du spielen musst!

Ein ausnotiertes Solo, das nicht überfordert, ist ein Genuss. Ein improvisiertes auch, wenn man sich sicher fühlt. Aufgelegte (angesichts des TrumpetScout-Harmoniewissens) schwierige Akkordsymbole hingegen befördern im persönlichen Fall Herzrasen und Schnappatmigkeit. Bei schönem Wetter auf dem Friedhof stehen und „Amazing Grace“ blasen ist selbst angesichts des traurigen Anlasses etwas Schönes, bei Minusgraden, wenn Töne nicht ansprechen, schlottern die Knie vielleicht nicht nur aus Kälte.
Übereifer oder Duckmäusertum – ein Konflikt
Die eigene Erwartungshaltung stellt einem gerne ein Bein, das wurde bereits gesagt. Dabei geht es nicht nur um das Umsetzen dessen, was in den Noten steht, sondern auch um eine mögliche Mehrleistung. Beispiele aus dem TrumpetScout-Leben sind vor allem die als optional gekennzeichneten Töne, vornehmlich in der Big Band, wenn einzelne Stelle oder Töne oktaviert werden sollten. Probiert man es oder probiert man es nicht? Geht man auf Nummer sicher und fühlt sich dann nachher wie ein Angsthase, der sich gedrückt hat? Oder soll man es angehen und vielleicht riskieren, dass man dem Gesamtklang durch schlechte Intonation schadet? Der innere Konflikt führt da auch gerne zu Bauchschmerzen. Es gibt gewisse Machotypen, denen solche Situationen nichts ausmachen. Dem TrumpetScout sind klare „oben“ notierte Töne ohne Alternative lieber – dann gehören sie eindeutig zum Stück. Übertragen lässt sich das sicher auch auf den Bereich der Marsch- und Polkamusik, wo Signale in der dritten Oktave gerne als fakultativ notiert sind. Hier muss man sich auch in Proben darüber klar werden: Geht es oder geht es nicht?
Keine falschen Prägungen: Fordern mit Maß statt Abhärten
Einige Menschen vertreten die Ansicht, der Kopf sei wie ein Muskel und wachse mit seine Anforderungen. Das stimmt teilweise, die Dinge liegen im Schädel aber komplexer als im Fleisch um die Knochen. Wer vor allem als Dirigent einen jungen Musiker aufbauen möchte, kann ihn nicht einfach mir nichts dir nichts vor das Orchester stellen und den Spielbefehl in der Hoffnung geben, dass er irgendwann ein guter Solist werden wird. Der TrumpetScout erinnert sich mit Grauen an „Fanfare for the Common Man“, dessen Entrée er als Zwölfjähriger in seiner heimatlichen Blaskapelle stets als Opener der zweiten Bierzelthälfte hervorbringen musste. Alleine über einem Panik hervorrufenden Paukenwirbel. Das ging nie wirklich gut und war dadurch immer mit Schande behaftet nach dem Solo und mit Appetitlosigkeit zuvor. Spaß an der Musik? Zero. Positive Prägung der Solistenrolle? Pas du tout!

Soli dürfen natürlich fordernd sein und selbstverständlich darf im Bierzelt auch einiges schief gehen (wo, wenn nicht dort?), wenn am Ende der Experimente ein besserer Musiker steht. Ein beständiger Sturz ins kalte Wasser kann aber auch schaden und einem die Freude an der Musik verleiden. Die richtige Balance zwischen technischer Ambition und Affirmation des Selbstvertrauens ist wichtig. Dabei spielt das Alter keine Rolle. Auch 50-Jährige können eine Zitterlippe bekommen. Bei der Solozuteilung sollte hier viel Augenmerkt auf den individuellen Charakter wert gelegt werden. Sobald jemand aber beständig gerade Töne herausbringt, sollte er auch solistisch auftreten, wenn es das Repertoire ermöglicht. Der Spruch „Man wächst mit seinen Aufgaben“ hat einfach seine Berechtigung.
Lampenfieber und Ausdauer
Ohne auf den ganzen Apparat der Tonerzeugung mit seinen Komponenten im Trompeterkörper genauer eingehen zu wollen ist klar: Entspanntheit bedeutet maximale Leistungsbereitschaft, Angespanntheit bedeutet Leistungsverlust. Wie sind wir im Fluchtmodus mit Lampenfieber? Leider nicht entspannt. Das wirkt sich nicht nur auf die Tonqualität, sondern auch ganz massiv auf die Ausdauerleistung aus. Wer ein forderndes Repertoire vom Blatt spielen muss und in jeder Sekunde fürchtet, einen Fehler zu machen, der merkt ganz schnell, dass einen nach kurzer Zeit die Kraft verlässt. Das System funktioniert nicht mehr wie es soll, Kompensationsmechanismen im Hals und in der Gesichtsmuskulatur verschlimmern den Energieverbrauch weiter.
Du liest viele, die meisten oder gar alle TrumpetScout-Artikel? Du hast vielleicht sogar schon ein Lob in Kommentaren oder einer Email kundgetan? Dann unterstütze die Seite bitte mit einer Spende, damit du auch weiterhin wöchentlichen Lesestoff bekommst: paypal.me/trumpetscout Vielen Dank!
Kenntnis der Literatur ist also ein großer Vorteil. Sie bringt Sicherheit, die wiederum bringt Entspanntheit. Jeder dürfte aus der eigenen Erfahrung wissen, dass einen manche Stücke kaum Kraft kosten und einem beinahe schon wieder eine „zweite Luft“ verschaffen, wogegen bei manchem Neuen, das einem die höchste Konzentration abnötigt, schon nach kurzer Zeit die Lefze hängt.
Was tun gegen den Leistungseinbruch?
Wer seine Literatur im Proberaum sehr gut beherrscht und dennoch bei jedem Auftritt beständig die Hälfte vergeigt, der hat ein Problem, das sich nicht über Entspannungs- oder Atemübungen lösen lässt, die zumeist nur Symptome angehen, nicht aber Ursachen. Er oder sie braucht dann professionelle und individuelle Hilfe. Und an dieser Stelle nur ganz kurz, aber umso heftiger: Alkohol oder andere Beruhigungsmittel sind keine professionelle Hilfe!
Wer „nur“ Auftrittsangst hat, also zuvor schlecht schläft und nicht mit Lust essen kann, aber „abliefert“, der darf sich über entgangene Lebensfreude ärgern, macht das aber in der Regel durch gesteigerte Spielfreude wieder wett, da sich üblicherweise die Anspannung im Vorfeld ganz schnell mit den ersten Tönen legt, spätestens aber mit den hinter sich gebrachten Angststellen. Dennoch sollte man sich hier mit der Zeit positiv programmieren können. Routine und beständige Erfolgserlebnisse wirken beruhigend.

Wessen Unterleib oder Mundhöhle berechtigt Paniksignale aussendet, weil das bevorstehende Programm einen beständig überfordert, der sollte das Programm (manchmal heißt das auch die Band) wechseln. Das klingt leichter gesagt als getan. Der TrumpetScout bekommt oft genug Noten vorgelegt, die zu schwer sind und die er am liebsten tauschen würde. Einzig, es geht nur selten. Mittlerweile führt das zwar persönlich nicht mehr zu einem Leistungseinbruch, aber eben auch nicht zu guter Musik, wie man es sich als Spieler wünscht. Stücke, die nur 70 bis 80 % des Übezimmerpotentials abverlangen, ermöglichen nicht nur ein angstfreieres Spielen, sondern – und das ist ja das Entscheidende – ein musikalischeres.
Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt: Sei gut vorbereitet und beherrsche, was du spielen musst! Wer sich sicher ist, dass er kann, was verlangt wird, wird maximal vor Aufregung nicht schlafen können, da er sich auf den Auftritt so freut, nicht sich aber vor Angst winden und das Klo durchgängig besetzen.

